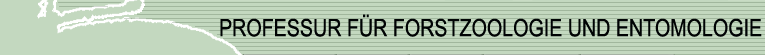Funktionelle Ökologie und Organismische Biologie
Chemische Signale (Infochemikalien) vermitteln auf verschiedenen Ebenen, wie Fortpflanzungsbiologie (innerartliche Kommunikation), Schutzmechanismen oder Performance (zwischenartliche Kommunikation) komplexe Beziehungen zwischen Tieren und Pflanzen in Lebensgemeinschaften.
Intraspezifische Beziehungen
 |
|||
Interspezifische Beziehungen
Biologie und Ökologie
Pharmakophagie bezüglich PA betrifft einen speziellen Fall von Verschränkung inner- und zwischenartlicher Kommunikation. Mit diesem Wissens- und Erfahrungshorizont befassen wir uns mit Fragen der Partnerfindung und -wahl, der Wirtsfindung und -wahl und mit Schutzmechanismen auch an nicht pharmakophagen Systemen. Chemische Signale interessieren auf allen Ebenen vorrangig, jedoch werden auch Naturstoffe betrachtet, die z.B. die Entwicklung von Insekten beeinflussen, da es letztlich darum geht, die komplexen Beziehungen zwischen Lebewesen zu verstehen - nur dann können Management-Maßnahmen abgeleitet werden. Der vergleichende Ansatz trägt zum Verständnis der Entwicklung von Kommunikations- und Schutzmechanismen bei.
Pheromonbiologie
Pheromone - Semiochemikalien zur innerartlichen Verständigung - sind besonders im Rahmen des Sexualverhaltens von großer Bedeutung, einerseits damit sich potentielle Geschlechtspartner finden, andererseits zur Partnerwahl. Grundlegende Studien betreiben wir insbesondere an Bärenspinnern und Monarchfaltern; bei beiden Gruppen sind gänzlich unterschiedliche Partnerfindungsmechanismen realisiert (Anlockung der Männchen durch weibliche Duftstoffe bzw. Auffinden von Weibchen durch Männchen mittels optischer Reize), große Ähnlichkeiten bestehen jedoch bei der Partnerwahl, bei der Duftstoffe der Männchen entscheidend sind.
Neben dem Studium der Signale produzierenden Drüsenorgane, der Chemie und Biogenese der Duftstoffbuketts, der Spezifität ihrer Wahrnehmung und ihrer Funktion(en) befassen wir uns speziell auch mit der Variabilität der Ausstattung mit Pheromonen zwischen Individuen einer Art bzw. zwischen Populationen.
Man ist geneigt anzunehmen, dass die Kenntnis der Chemie von Infochemikalien, die eine Lockwirkung besitzen, unmittelbar dazu führt, diese Stoffe z.B. im Rahmen der Schädlingsbekämpfung anwenden zu können. Allerdings handelt es sich i.d.R. um hoch volatile Stoffe, die unter Freilandbedingungen sehr leicht zerfallen. In der Konfektionierung von Lockstoffen liegen deshalb große Aufgaben.
Durch die Tatsache, dass Pheromone oft mit Signalen anderer Modalität (Optik, Akustik) verschränkt sind, wird Pheromonbiologie noch komplexer. Wie die Pheromone selbst sind diese für uns oft nicht wahrnehmbar, da sie im ultravioletten oder Ultraschall-Bereich liegen.
Qualitative und quantitative Unterschiede zwischen Pheromonbuketts verschiedener Arten bewirken eine sehr hohe Spezifität. Allerdings haben sich viele Gegenspieler (Fressfeinde, Parasitoide) derart angepasst, dass sie die Pheromone ihrer Wirte wahrnehmen und sie so aufspüren können. Auch dieser Aspekt ist bei der Anwendung von Pheromonen im Pest-Management sehr bedeutungsvoll.
Schutzmechanismen
Beim Schutz vor Fressfeinden spielen nicht nur Verhaltensweisen und mechanischer Schutz eine Rolle, sondern insbesondere selbst-produzierte oder von Wirtspflanzen aufgenommene Substanzen, welche die Tiere ungenießbar ('giftig') machen. Solche Naturstoffe können entweder abschrecken oder auch unmittelbar schädliche Effekte für Feinde haben.
Wehrhaftigkeit und Ungenießbarkeit werden durch auffällige Verhaltensweisen und oder Trachten signalisiert - und es gibt Organismen, welche diese Signale nachahmen und ein Geschütztsein vortäuschen (Stichwort "Mimikry"). Auch hier sind oft UV-Muster und Ultraschall-Laute beteiligt.
Effekte sekundärer Pflanzenstoffe für Tiere - "Performance"-Studien
Wirtspflanzen haben auf die biologische Fitness und auf die Populationsdynamik von Insekten wesentlichen Einfluss. Uns interessieren dabei vorrangig die sekundären Pflanzenstoffe, die mit dem Nahrungserwerb oder auch unabhängig davon genutzt werden, d.h. die Performance von Individuen und Populationen in Abhängigkeit von Wirtspflanzen, Ursachen von Wirtsspezifitäten, obligate / fakultative Polyphagie, Variabilität innerhalb von Wirtspflanzen einer Art, sowie Kosten und Nutzen des Abbaus / der Sequestrierung pflanzlicher Sekundärstoffe.
Für derartige Fütterungsexperimente nutzen wir unser Kunstfutter, die hinsichtlich pflanzlicher Sekundärstoffe neutral ist; somit können quantitativ verschiedene Sekundärstoffe zugefügt und deren Auswirkungen auf die Performance monofaktoriell untersucht werden.