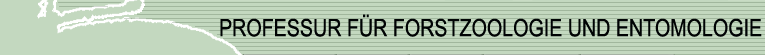Aus der Geschichte des Forstzoologischen Instituts
Am 1. April 1920 wurde die forstliche Ausbildung von Karlsruhe nach Freiburg verlegt. Neben den drei Ordinariaten Produktionslehre, Betriebslehre und Forstpolitik wurden drei Extraordinariate für Forstschutz und Forstbenutzung, Forstzoologie und Bodenkunde eingerichtet.
Das Extraordinariat für Forstzoologie, das anfangs mit einem persönlichen Ordinarius besetzt war, wurde 1939 in ein planmäßiges Ordinariat umgewandelt.
Die forstlichen Fachgebiete Produktionslehre, Betriebslehre und Forstpolitik waren bis 1935 im Forstlichen Institut zusammengefasst; dieses gehörte mit den Instituten der forstlichen Grundwissenschaften (Bodenkunde, Forstzoologie, Forstbotanik) ohne nähere Bindung untereinander der naturwissenschaftlichmathematischen Fakultät an.
Das Forstliche Institut war zusammen mit der Badischen Forstlichen Versuchsanstalt und dem Institut für Bodenkunde in der Neuen Universität untergebracht, die Forstzoologie zog in das Botanische Institut ein.
1927 wurden dem Forstlichen Institut und der Versuchsanstalt Räume im Gebäude der Alten Universität zur Verfügung gestellt. Das Raumproblem der Forstzoologie konnte erst 1942 mit der Übersiedlung in die Maximilianstraße gelöst werden.
Der Bombenangriff im November 1944 beendete den Lehr- und Forschungsbetrieb der Forstlichen Abteilungen. Sämtliche Institute wurden obdachlos und verloren wertvolle Einrichtungen, Sammlungen und Bibliotheken.
Nach dem Umbruch wurde die Lehrtätigkeit teilweise in den Wohnungen der Professoren durchgeführt, bis im Frühjahr 1946 von der Stadt das Anwesen Fürstenbergstraße 21 zur Verfügung gestellt wurde. Im Frühjahr 1949 wurde der Wiederaufbau der Alten Universität in Aussicht gestellt, und im Sommer 1952 konnten alle Forstlichen Institute in die Alte Universität in der Bertoldstraße 17 einziehen.
Direktoren und Forschungsschwerpunkte des FZI
1920-1935 Prof. Dr. Robert Lauterborn |
 |
| Von Haus aus Biologe, hat Lauterborn sich vor allem durch die Erforschung des Rheins einen internationalen Namen gemacht. Neben seiner Lehrtätigkeit widmete er sich in Freiburg hauptsächlich seinem Werk "Der Rhein. Naturgeschichte eines deutschen Stroms". Der erste Band erschien in drei Teilen mit über 1000 Seiten in den Jahren 1930-1938. Der zweite, der die Biologie im Zusammenhang mit der Geologie behandeln sollte, verzögerte sich durch Kriegseinfluss; große Teile des Manuskriptes verbrannten 1943 bei einem Bombenangriff. Während seiner Zeit in Freiburg befasste er sich meist mit süßwasserbiologischen, vegetationskundlichen und wissenschaftshistorischen Fragen. Er setzte sich für die Erhaltung des biologischen Gleichgewichts ein und warnte vor unbedachten anthropogenen Eingriffen in die natürlichen Lebensgemeinschaften, vor allem auch bei der chemischen Bekämpfung von Forstschädlingen. Insgesamt liegen von Lauterborn 141 Veröffentlichungen – darunter mehrere Bücher – vor. |
|
| 1936-1940 Prof. Dr. Wilhelm Zwölfer Zwölfer, ein Schüler und Mitarbeiter von Prof. Dr. Escherich in München, wurde 1936 auf den Lehrstuhl berufen und 1937 zum ordentlichen Professor ernannt. Bereits 1940 folgte er einem Ruf nach München, wo er als Nachfolger seines Lehrers Escherich den Lehrstuhl für angewandte Zoologie übernahm und Direktor des Instituts für angewandte Zoologie der Forstlichen Forschungsanstalt wurde. |
 |
| Zwölfers Ansehen gründet sich besonders auf seine Arbeiten über die Epidemiologie der Insekten mit besonderer Berücksichtigung der mathematischen Behandlung dieses Problems, die auf eingehenden experimentell-ökologischen Untersuchungen über die Wirkung der klimatischen Faktoren wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit beruhen. Zwölfer schuf so grundlegende Arbeiten über die Populationsdynamik wichtiger Forstschädlinge wie Nonne und Kieferneule; gleichzeitig arbeitete er an der Entwicklung von Geräten zur Durchführung experimenteller ökologischer Untersuchungen wie z.B. dem Brückenthermostaten. Die von ihm in den 30er Jahren begründete und in der darauffolgenden Zeit ausgebaute experimentell-ökologische Forschungsrichtung innerhalb der angewandten Entomologie hat zu entscheidenden Fortschritten in der land- und forstwirtschaftlichen Schädlingskunde, aber auch im Vorrats- und Materialschutz sowie der medizinischen Entomologie geführt. |
|
| 1940-1960 Prof. Dr. Karl Ernst Merker Vor der Übernahme des Lehrstuhls galt sein Interesse physiologischen und ökologischen Problemen, die er an einheimischen Süßwassertieren studierte und in 89 Publikationen niederschrieb. Merker fiel zunächst die schwere Aufgabe zu, die Institutseinrichtungen und vor allem die unersetzlichen Sammlungen und Buchbestände vor Kriegsschäden zu bewahren, was ihm zum größten Teil glückte. Er meisterte auch die Aufrechterhaltung des Lehrbetriebs und den Aufbau eines neuen Instituts nach dem Krieg. |
 |
| Die schon in den letzten Kriegsjahren erkennbare Borkenkäferplage sollte dann über ein Jahrzehnt die Arbeitsrichtung des Instituts bestimmen. Daneben arbeitete er auch an der kleinen Fichtenblattwespe und den forstschädlichen Tannenläusen. 1957 wurde Dreyfusia merkeri, die "Freiburger Tannenlaus", nach ihm durch Eichhorn benannt. Unter seiner Leitung hat sich das FZI "zur besonderen Aufgabe gemacht, die Massenvermehrung von Schädlingen weniger durch die Anwendung von chemischen Mitteln zu bekämpfen, sondern nach genauem Studium den Schädling durch biologische Methoden an der Massenvermehrung zu hindern". Nach seiner Emeritierung arbeitete Merker eingehend zum Einfluss des Standortes und der Beschaffenheit der Wirtspflanzen auf die Entwicklung und Sterblichkeit der an ihnen lebenden Schadinsekten. Merkers bahnbrechende Erkenntnisse waren nicht nur für Waldbautechniken und den Forstschutz, sondern auch für den gesamten Pflanzenschutz von großer Bedeutung. |
|
| 1960-1970 Prof. Dr. Dr. Gustav Wellenstein Schon zu Beginn seiner wissenschaftlichen Laufbahn hatte er es sich zur Aufgabe gemacht, den Wald vor Schädlingskalamitäten zu schützen. So wurde ihm die Bekämpfung der Massenvermehrung der Nonne in Ostpreußen (1933-37) übertragen. Zugleich erforschte er mit seinen Mitarbeitern die Ursachen für diese Gradationen. Den an der Universität Königsberg im Fach "Forstliche Zoologie und Waldhygiene" habilitierten Wellenstein verschlug es dann nach Kriegsende nach Südwestdeutschland, wo sich in den Wirren jener Zeit eine große Borkenkäferkalamität (1944-1951) entwickelt hatte, an deren Bekämpfung er maßgeblich beteiligt war. |
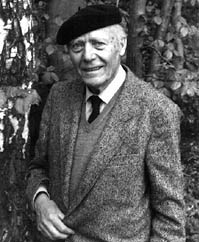 |
| Die Ergebnisse dieser langjährigen wissenschaftlichen und bekämpfungstechnischen Studien wurden unter seiner Federführung als Gemeinschaftswerk in zwei bedeutenden Monografien veröffentlicht ("Die Nonne in Ostpreußen 1933-37" und "Die große Borkenkäferkalamität in Südwestdeutschland 1944-51"). Aus letzterem Arbeitsauftrag entwickelte sich die "Forstschutzstelle Südwest", deren Leitung ihm 1949 übertragen wurde. 1955 erhielt er eine Dozentur für Forstschutz an der Universität Freiburg, an der er dann 1960 den Lehrstuhl für Forstzoologie übernahm. Hier machte Wellenstein Waldhygiene und biologische Bekämpfung von Schadinsekten zum Schwerpunkt seiner Forschungen. Zu Zeiten, als in der breiten Öffentlichkeit noch niemand von "Umweltschutz" und "Ökologie" sprach, setzte er sich für Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz ein. Die Suche nach hygienisch vertretbaren Methoden im Forstschutz und die Reinhaltung unseres Lebensraumes kennzeichnen sein wissenschaftliches Werk als Hochschulprofessor, das immer auf die Praxis ausgerichtet war. Mehr als 300 Publikationen zeugen davon. Schwerpunktmäßig befasste sich Wellenstein auch mit der Schaffung krisenfester Waldbestände durch prophylaktische Maßnahmen wie z.B. Ameisenhege, Vogelschutz, waldbauliche Veränderungen des Waldgefüges, sowie Düngungsmaßnahmen. Großes Interesse galt ferner der Anwendung insektenpathogener Viren und Bakterien zur Schädlingsbekämpfung, sowie Fragen der Belastung unserer Umwelt durch Pestizide und andere Fremdstoffe und deren Nebenwirkungen auf Mensch und Tier. Ein anderer wesentlicher Teil seines Lebenswerkes war die Erforschung der Zusammenhänge zwischen Waldameisen, Honigtauinsekten und Waldhonigernte. Jedem Imker ist der Name Wellenstein geläufig. Nach jahrelanger Arbeit an der Kartierung der Waldameisen erstellte er Bienenwanderkarten, die den Imkern Hinweise auf ertragreiche Standorte nannte, so dass sie das große Waldhonigpotential unserer Wälder gezielter nutzen konnten. Dies brachte ihm zahlreiche Anerkennungen und Ehrungen, u.a. die Verleihung der Verdienstmedaille des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND). Auch nach seiner Emeritierung 1973 arbeitete Wellenstein bis zu seinem Tode 1997 fast täglich am Institut. |
|
| 1973-1990 Prof. Dr. Jean-Pierre Vité Auch Vité war mit seinen Gedanken zu Ökologie und Umwelt seiner Zeit voraus. Bereits seine erste Publikation (1949) trägt den Titel "Die ökologische Gliederung des Waldes", seine Dissertation hat "Untersuchungen über die ökologische Bedeutung der Spinnen für die Lebensgemeinschaft des Waldes" zum Thema. Außer mit Spinnen des Waldes beschäftigte er sich in seinen früheren wissenschaftlichen Arbeiten mit diversen Holzschädlingen, sowie mit Buchen- und Lärcheninsekten. |
 |
| Nachdem Vité 1954 als 31-jähriger in Gießen im Fach Forstzoologie habilitierte, ging er bereits 1956 in die USA, wo er von 1957 bis 1973 am Boyce Thompson Institute for Plant Research die Abteilung Forstliche Biologie leitete und die Freiheit und die Mittel für seine wegweisenden Untersuchungen über die Wirtswahl und die Pheromonbiologie der Borkenkäfer fand. Boppré M (2007) Lockstoff-Fallen für das Borkenkäfer-Management. Jean-Pierre Vités (*1923) Beitrag zum Biotechnischen Waldschutz. Pp 269-273 in Rüchardt C et al. (Hrsg.) 550 Jahre Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 1457-2007. Band 4. Wegweisende naturwissenschaftliche und medizinische Forschung. Freiburg i.Br.: Verlag Karl Alber. lesen / read |
|
Bauten und Räumlichkeiten
aus: Martin B (Hrsg.) (2007) 500 Jahre Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. Festschrift. Band 5 Die Fakultäten und Institute seit 1945. Freiburg: Verlag Karl Alber
Aus Raumnot zog das Forstzoologische Institut 1942 in ein Haus in der Maximilianstraße um (ab 1927 waren die Forstlichen Institute in der Alten Universität in der Bertoldstraße untergebracht). 1944 wurde die Alte Universität bei einem Bombenangriff zerstört. Nach dem Neuausbau zog das Forstzoologische Institut dort 1952 wieder ein. Von 1962-1978 hatte das Institut auch Räume (eine Baracke) auf dem städtischen Gelände in der Urachstraße. Bis 1987 hatte das Institut Gelände (Wiesen) an der Wonnhalde gepachtet.
1987 Übernahme des Anwesens in Stegen-Wittental (zuvor FVA, Abt. Waldschutz), bis 1992 gemeinsam mit Institut für Bodenkunde
1999 Umzug des Stamminstituts aus der Alten Universität in provisorische Räume in der Tennenbacher Straße (Herder-Gebäude)
1999 Einweihung eines neu errichteten Laborgebäudes in Stegen-Wittental
2004 Molekulargenetisches Labor am Flughafen
Strukturelle Veränderungen
1979 Einrichtung der Professur für Waldschutz (C3)
1981 Einrichtung der Professur für Wildökologie und Jagdwirtschaft (C3)
1991 Wegfall der Professur für Waldschutz
2004 Neuorientierung der Professur für Wildökologie und Jagdwirtschaft in Professur für Wildtierökologie und -management
Wissenschaftliches Profil
| 1940-1960 | Bekämpfung des Fichtenborkenkäfers; Schadinsekten und standörtliche Gegebenheiten; phytophage Insekten und die Nährpflanzensuche; Tannenläuse |
| 1960-1970 | Waldameisen; Bekämpfung forstlicher Großschädlinge; Biologische Schädlingsbekämpfung |
| 1970-1990 | Chemisches Kommunikationssystem von Borkenkäfern; Bekämpfung von Borkenkäfern mit synthetischen Pheromonen; Biologische Schädlingsbekämpfung; Borkenkäfer Brasiliens; Ernährung, Populationsdynamik und Bewirtschaftung einheimischer Wildarten |
| seit 1990 | Chemische Ökologie, insbes. Pheromonbiologie, Physiologie und Ökologie chemischer Kommunikation bei Insekten; Pharmakophagie unter funktionellen, ethologischen, ökophysiologischen, chemisch-ökologischen, entwicklungsbiologischen und phylogenetischen Gesichtspunkten; Anwendung sekundärer Pflanzenstoffe im Rahmen des Integrierten Pflanzenschutzes |
| seit 2004 | Neuorientierung des Profils bzgl. Wildtieren (s.u.) |
Entwicklung der Lehre
- Schießausbildung zum Erwerb des Jagdscheins ab 1992 dem Jägerverein übertragen
- Verstärkte Ausrichtung auf biozönotische Konnexe
- Zunehmende Berücksichtigung der Tropen und Subtropen sowie individueller Bildungsprofile
Ausblick
Biozönoseschonende Verfahren des Schädlingsmanagements; pflanzliche Sekundärstoffe und ihre vielfältigen Einflüsse auf Verhalten und Physiologie von Tieren (Konsumenten 1. und 2. Ordnung), insbes. pharmakophage Nutzung sekundärer Pflanzenstoffe durch Tiere; Bedeutungen von Neobiota; Biodiversitätsinformatik (Datenbankstruktur CoenoSys® zur Erfassung, Auswertung und Darstellung von Lebensgemeinschaften); Faunistik, Taxonomie und Systematik tropischer Insekten; Gesundheitsrisiken durch Naturstoffe (z.B. Honig und andere Bienenprodukte); Selbstmedikation bei Tieren
Bedeutung der räumlichen Struktur und der menschlichen Nutzung von Lebensräumen für die Verbreitung, Dynamik und Genetik von Tierpopulationen sowie die Entwicklung von Konzepten zur Integration von Landnutzungsinteressen und der Erhaltung von Wildtieren und Biodiversität: Wildtier-Habitat Beziehungen; Landschaftsmuster und räumliche Struktur von Wildtierpopulationen; Faunistische Veränderungen und Biodiversität; Modellierung von Populationsprozessen; Naturschutzbiologie und Artenschutz (Conservation Biology); molekulare Populationsökologie (Conservation Genetics); Mensch-Wildtier Beziehungen (Human Dimensions of Wildlife Management)
ProfessorInnen
- Prof. Dr. Karl Ernst Merker (22.09.1888-14.12.1974), C4, 1940-1960
- Prof. Dr. rer. nat. Dr. forest. Gustav Wellenstein (27.07.1906-14.08.1997), C4, 1960-1970
- Prof. Dr. rer. nat. Rolf Lange (kommisarisch) (17.08.1924-22.11.1975), 1970-1973
- Prof. Dr. forest. Jean-Pierre Vité (*11.06.1923), C4, 1973-1991; 1957-1973: Direktor am Boyce Thompson Institute for Plant Research, Gastprofessor an Staatsuniversitäten von Oregon (Corvallis), Kalifornien (Berkeley) und Texas (A&M); 1969: Ehrenbürger des US-Bundesstaates Texas; 1981: Karl-Abetz-Preis; 1988: Bundesverdienstkreuz 1. Klasse
- Prof. Dr. rer. nat. Michael Boppré (*03.12.1950), C3, Professur für Waldschutz 1987-1991; C4, 1991-heute; 1990: Berufung auf die o. Professur für Angewandte Zoologie, Bonn
- Prof. Dr. rer. silv. Joachim Schönherr (*23.02.1926), C3, Professur für Waldschutz 1979-1991; 1972-1974: Professor an der Universität Paraná/Brasilien; 1992: Ehrendoktor der Universität Curitiba/Brasilien
- Prof. Dr. rer. nat. Detlef Eisfeld (26.06.1939-06.01.2006), C3, Professur für Wildökologie und Jagdwirtschaft 1981-2004
- Prof. Dr. rer. nat. Ilse Storch (*18.03.1961), C3, Professur für Wildtierökologie und -management 2004-heute